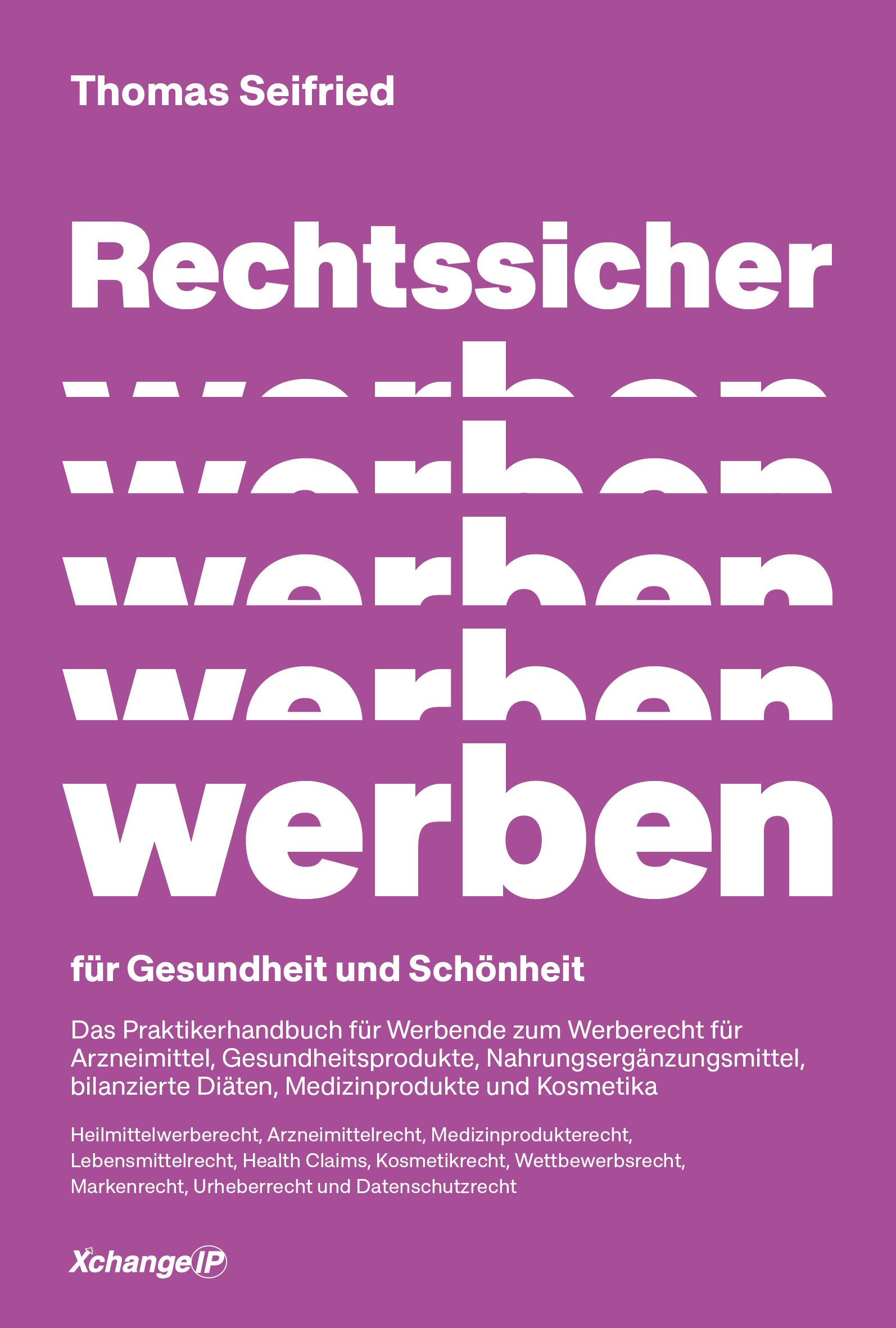Kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falles durch Ihren Anwalt für Heilmittelwerberecht
Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Rechtsanwalt Thomas Seifried hat über 20 Jahre Erfahrung im
Wettbewerbsrecht und Werberecht und ist seit 2007 auch
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Seine Mandanten sind Unternehmen, vom Start-Up bis zum börsennotierten Unternehmen, darunter Apotheker, Unternehmen der Gesundheitsbranche und der Kosmetikbranche. Thomas Seifried ist Autor des Praktikerhandbuchs zum Werberecht für Arzneimittel, Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika
"Rechtssicher werben für Gesundheit und Schönheit" und schreibt regelmäßig Beiträge zum Werberecht für Fachzeitschriften, beispielsweise für die Zeitschriften "HORIZONT" oder auf
heise.de. Er berät und vertritt als Anwalt für Heilmittelwerberecht bundesweit Unternehmen außergerichtlich und gerichtlich, insbesondere in
einstweiligen Verfügungsverfahren mit
zahlreichen Erfolgen vor Landgerichten und Oberlandesgerichten.
Sie suchen einen Anwalt für Heilmittelwerberecht?
Heilmittelwerberecht beschränkt Werbung für Arzneimittel und andere gesundheitsrelevante Produkte für Mensch und Tier
Das Heilmittelwerberecht ist im Heilmittelwerbegesetz (HWG) geregelt. Das HWG schützt Verbraucher vor
irreführender Werbung und unsachlicher Beeinflussung für Mittel und Verfahren zur Behandlung von Krankheiten. Das HWG verbietet bestimmte Arten von Werbung mit Aussagen, die die Gesundheit betreffen. Das Heilmittelwerbegesetz regelt Werbung für Arnzeimittel, andere Heilmittel. Betroffen sind auch Nahrungsergänzungsmittel (NEG).
Die Werbung für Medizinprodukte wir inzwischen abschließend von der Medizinprodukte-VO geregelt. Auch die Werbung für kosmetische Mittel (Kosmetikprodukte) unterfällt - entgegen dem Wortlaut - nicht mehr nach dem HWG, sondern abschließend der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (EU-Kosmetikverordnung).
Das Heilmittelwerbegesetz verbietet bestimmte Werbeaussagen nur in Bezug zu einem Produkt, nicht aber reine Imagewerbung ohne Bezug zu einem Produkt, z.B. Unternehmenswerbung (siehe unten). Eine Unternehmenswerbung oder Imagewerbung, die sich nicht auf ein konkretes Produkt bezieht, wird vom Heilmittelwerberecht nicht erfasst.
Irreführende Werbung über ein Unternehmen ist vielmehr im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geregelt. Verstöße gegen das Heilmittelwerberecht werden oft mit einer
Abmahnung im Wettbewerbsrecht oder mit einem
einstweiligen Verfügungsverfahren verfolgt.
Unverzichtbar für Apotheker und Drogisten:
"Rechtssicher werben für Gesundheit und Schönheit"
Das Praktikerhandbuch zum Arzneimittelwerberecht, zur Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, Health Claims, bilanzierte Diäten, Medizinprodukte und Kosmetika - Im Buchhandel oder bei
Amazon
Werbung für gesundheitsbezogene Produkte ist rechtlich besonders reglementiert. Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an gesundheitsbezogene Aussagen. Werbung für Arzneimittel und andere Heilmittel, Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, bilanzierte Diäten und Kosmetika ist außerdem durch spezielle Gesetze und Verordnungen eingeschränkt. Die Gefahr von Abmahnungen und Rechtsstreitigkeiten ist bei diesen Produkten besonders hoch. Das Buch stellt die aktuelle Rechtslage anhand mehrerer hundert Beispielen aus der Rechtsprechung dar.
Aus dem Inhalt:
- Auswahl von Begriffen, Texten und Medien
- Werbung mit Marken
- Allgemeine wettbewerbsrechtliche Grundsätze, irreführende Werbung und vergleichende Werbung, Werbung mit Preisen und Rabatten
- Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, Social Media- und Influencer-Marketing
- Generelle Anforderungen an gesundheitsbezogene Werbung
- Heilmittelwerberechtliche Verbote und Einschränkungen
- Werbung für Arzneimittel, Arzneimittelpreisbindung, Werbung mit Rabatten und Zugaben
- Werbung für Medizinprodukte
- Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere HEALTH CLAIMS
- Werbung für bilanzierte Diäten
- Werbung für kosmetische Mittel
Zum Inhaltsverzeichnis
1. Auflage November 2024, 408 Seiten, XchangeIP Verlag, erhältlich im Buchhandel oder bei Amazon
ISBN 978-3-00-079406-3
Für wen gilt das Heilmittelwerbegesetz (HWG)?
Werbung für Arzneimittel und andere gesundheitsrelevante Mittel und Verfahren, auch für Tiere
§ 1 HWG definiert den Anwendungsbereich des Heilmittelwerbegesetztes. Das HWG gilt demnach für Werbung für
- Arzneimittel nach § 2 Arzneimittelgesetz (AMG),
- andere Mittel, Verfahren, Behandlungen und Gegenstände, soweit sich die Werbeaussage bezieht
- auf die Erkennung, Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden beim Menschen,
- auf Schwangerschaftsabbrüche,
- auf operative plastisch-chirurgische Eingriffe zur Veränderung des menschlichen Körpers ohne medizinische Notwendigkeit.
"Andere Mittel" sind auch kosmetische Mittel im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (EU-Kosmetikverordnung).
"Gegenstände" sind auch Gegenstände zur Körperpflege im Sinne des § 2 Absatz 6 Nummer 4 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. - Verfahren und Behandlungen, soweit sich die Werbeaussage auf die Erkennung, Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden beim Tier bezieht.
Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika gehören nicht mehr zum Anwendungsbereich des § 3 HWG. Denn für diese Produkte wird die Irreführung abschlie-ßend nach europäischem Recht geregelt, nämlich nach Art. 7 MDR bzw. Art. 7 der In-vitro-Diagnostika-Verordnung.
Was ist "Werbung" im Sinne von § 1 Heilmittelwerbegesetz?
Keine Definition von "Werbung" im Heilmittelwerbegesetz
Für den Begriff der „Werbung“ findet sich im Heilmittelwerbegesetz keine gesetzliche Definition. Die Rechtsprechung definiert heilmittelwerberechtlich relevante Werbung als Werbung, die die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise erregen und deren Interesse wecken und so
den Absatz von Waren oder Leistungen fördern soll (BGH, Urteil v. 27.4.1995 - I ZR 116/93 - Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie). Diese Definition ähnelt der generellen wettbewerbsrechtlichen Definition von Werbung.
Definition von "Werbung für Arzneimittel"
Bestimmte Werbebeschränkungen des HWG gelten nach dem Gesetz nur für Arzneimittel (§§ 3a, 4, 4a, 5, 10, 11 I Nr. 1 bis Nr. 15, 11 II, 12 I Nr. 1 HWG). Nach der Rechtsprechung (OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.12.2019 – 6 U 189/18 - Melissenextrakt) und dem für die Auslegung des Heilmittelwerbegesetzes verbindlichen Art. 86 I Hs. 1 der EU-Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel ist Werbung für Arzneimittel
"alle Maßnahmen zur Information, zur Marktuntersuchung und zur Schaffung von Anreizen mit dem Ziel, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arzneimitteln zu fördern“.
Eine Werbung für ein Arzneimittel liegt vor, wenn der Verbraucher den ausdrücklich beworbenen Wirkstoff mit dem Medikament gleichsetzt (BGH, Urteil vom 29.10.1992 - I ZR 89/91 – Bronchocedin) oder wenn nicht der Wirkstoff, sondern die Pflanze, aus den der Wirkstoff gewonnen wird, mit dem Arzneimittel gleichgesetzt wird (OLG Koblenz, Urteil v. 14.12.2016 - U 941/16 - Passionsblume). "Werbung" im Sinne des HWG kann auch eine Aussage auf einer Packungsbeilage sein (vgl. BGH v. 29.05.1991 - I ZR 284/89 - Katovit).
HWG nur für Produktwerbung anwendbar
Nicht für jede Werbung für Heilmittel gilt das Heilmittelwerbegesetz. Das Heilmittelwerbegesetz beschränkt vielmehr nur Werbung für Produkte (Produktwerbung oder Absatzwerbung), nicht dagegen Firmenwerbung, also Unternehmens- und Imagewerbung. Es müssen also Heilmittel beworben werden, damit das Heilmittelwerbegesetz anwendbar ist, nicht etwa nur ganz allgemein ein Unternehmen.
Ob die zu beurteilende Werbung Absatzwerbung oder Firmenwerbung ist, hängt davon ab, ob nach dem Gesamterscheinungsbild der Werbung die Darstellung des Unternehmens oder aber die Anpreisung bestimmter oder zumindest individualisierbarer Produkte im Vordergrund steht. Auch eine Werbung für das gesamte Warensortiment einer Apotheke ist nicht etwa eine Firmenwerbung, sondern eine unter § 1 Abs. 1 Nr. HWG fallende Produkt- oder Absatzwerbung (BGH, Urteil vom 18.11.2021 – I ZR 214/18 - Unzulässige Werbung einer Versandapotheke – Gewinnspielwerbung II). Das gilt auch dann, wenn ein Teil des Sortiments keine Heilmittel umfasst (BGH v. 26.3.2009 - I ZR 99/07 - DeguSmiles & more).
Anwendbarkeit des HWG für Verfahren, Behandlungen und Gegenstände
Das HWG gilt auch für gesundheitsrelevante Werbung (vgl. § 1 I Nr. 2, II HWG) für Verfahren, Behandlungen und Gegenstände. Das können beispielsweise medizinische Therapien sein.
Weitere Beispiele:
"Verfahren und Behandlungen" sind
z.B. der Besuch einer Salzgrotte (OLG Saarbrücken v. 19.12.2018 - 1 U 41/18 - Besuch in der Salzgrotte)
"Gegenstände" sind
z.B. Kinesiologie-Tapes (BGH v. 20.02.2020 - I ZR 193/18 - Kundenbewertungen auf Amazon).
Irreführende Erfolgsversprechen nach § 3 S. 2 Nr. 2 a) HWG
Eine Irreführung nach § 3 S. 2 Nr. 2 a) HWG liegt besonders dann vor, wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass der Erfolg eines Heilmittels mit Si-cherheit erwartet werden kann. Verboten ist nicht das Versprechen eines Erfolgs an sich, sondern das Hervorrufen des Eindrucks, dieser sei sicher. Ob ein solcher Eindruck erweckt wird, hängt vom Verständnis eines durchschnittlichen Werbeadressaten ab und erfordert keine ausdrückliche Garantie in dem Sinne, dass ein sicherer Erfolg immer zu erwarten ist (OLG Düsseldorf v. 24.2.2022 – I-20 U 292/20 – Werbung eines Heilpraktikers mit einer Krankengeschichte). Es reicht aus, wenn der Eindruck erweckt wird, meistens könne ein sicherer Erfolg eintreten.
Beispiel
Die Aussage
„rasche und zuverlässige Reduktion der Intensität der typischen Erkältungssymptome“
für ein homöopathisches Arzneimittel ist eine unzulässiges Erfolgsversprechen (LG Dortmund v. 23.9.2022 – 25 O 22/22).
Täuschung über persönliche Eigenschaften oder Eigenschaften des Herstellers oder Erfinders nach § 3 S. 2 Nr. 3 b) HWG
Irreführend sind auch unwahre Angaben über die Person, Vorbildung, Befähigung oder Erfolge des Herstellers, Erfinders oder der für sie tätigen Personen. Praxisrelevant sind hier vor allem irreführende Berufs- und Institutsbezeichnungen.
Beispiele
• Irreführend ist die Werbung eines Zahnarztes, der nicht Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ist, mit
„Praxis für Kieferorthopädie“,
ohne aufklärenden Hinweis, dass er nicht Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ist (BGH v. 29.7.2021 – I ZR 114/20 - Kieferorthopädie).
• Irreführend ist die Bezeichnung
„Klinik“
für eine Praxis ohne Betten für einen stationären Aufenthalt (OLG Hamburg v. 2.9.2020 – 3 U 205/19 – Deutsche Stimmklinik).
Verbote für Werbung außerhalb der Fachkreise (Verbraucher) nach § 11 HWG für Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen und Mittel
Heilmittelwerbeverbote für Verbraucherwerbung
§ 11 HWG enthält einen Katalog von Werbeverboten gegenüber Verbrauchern für Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen und Mittel.
Nur eingeschränkte Geltung für Medizinprodukte
Für Medizinprodukte gelten nach § 11 Abs. 1 S. 2 HWG die meisten dieser Werbeverbote nicht, sondern nur die Verbote nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 bis 9, 11 und 12 HWG.
Verbot der Werbung mit fachlichen Empfehlungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 HWG
Für Heilmittel darf nicht mit Angaben oder Darstellungen, die sich auf eine Empfehlung von Wissenschaftlern, von im Gesundheitswesen und Tiergesundheitswesen tätigen Personen oder anderen Personen beziehen nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 HWG gegenüber Verbrauchern geworben werden. Eine fachliche Empfehlung muss nicht zwangsläufig von einer bestimmten Person ausgehen. Auch Werbung, die eine Empfehlung durch eine Personengruppe oder eine Branche suggeriert, ist verboten. Ebensowenig muss das Wort "Empfehlung" oder "empfiehlt" erscheinen.
Beispiele
Die Werbung
„Die moderne Medizin setzt daher immer öfter auf das pflanzliche Arzneimittel XY®…“
ist eine unzulässige fachliche Empfehlung (BGH, Urteil v. 18.1.2012 − I ZR 83/11 - Euminz).
Auch die Werbung
"ERKÄLTUNGSMEDIKAMENT DES JAHRES 2014 - GEWÄHLT VON [einem Berufsverband der Apotheker]"
ist eine unzulässige fachliche Empfehlung (OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 12.02.2015 - 6 U 184/14 - Öffentlichkeitswerbung),
ebenso eine Werbung für Hörgeräte mit der Aussage
"Vom HNO-Arzt empfohlen" (OLG Hamm, Urteil v. 13.6.2019 - I-4 U 5/19 - Werbung mit fachärztlicher Empfehlung für ein Hörgerät).
Mit "Wissenschaftlern" sind fachliche Autoritäten gemeint. Das kann auch ein "Studienkreis der Universität Würzburg" sein (OLG Koblenz, Urt. v. 14.12.2016 – 9 U 941/16 - Passionsblume).
Werbung mit Wiedergabe von Krankheitsgeschichten nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HWG
Werbungen mit Krankheitsgeschichten sind an sich zulässig. Nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HWG ist eine Werbung mit einer Krankheitsgeschichte nur dann unzulässig, wenn sie missbräuchlich, abstoßend oder irreführend ist oder durch eine ausführliche Beschreibung oder Darstellung zu einer falschen Selbstdiagnose verleiten kann. Die praktische Bedeutung der Regelung ist dementsprechend gering.
Werbung mit abstoßenden Darstellungen nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 HWG
Missbräuchlicher, abstoßender oder irreführende Darstellungen von Veränderungen des menschlichen Körpers durch Krankheiten oder Schädigungen oder die Wirkung eines Arzneimittels sind nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 HWG verboten. Eine dezente Darstellung von Lippesherpes ist noch nicht abstoßend (OLG Hamburg, Urteil v. 10.4.2008 - 3 U 182/07 - Darstellung von Lippenherpes in einem TV-Spot).
Verbot der Schleichwerbung mit abstoßenden Darstellungen nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 HWG
Veröffentlichungen, deren Werbezweck mißverständlich oder nicht deutlich erkennbar ist (Schleichwerbung) ist ebenfalls unzulässig, § § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 HWG. Hauptanwendungsfälle sind Anzeigen im Gewand redaktioneller Berichterstattung und das Influencer-Marketing.
Werbung mit Äußerungen Dritter nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 HWG
Nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 HWG ist Werbung mit Äußerungen Dritter verboten. "Dritte" sind Personen, die im Lager des Werbenden stehen und deren Meinung daher als glaubwürdig gilt. Das Gesetz nennt als solche Äußerungen ausdrücklich Dank-, Anerkennungs- und Empfehlungsschreiben. Betroffen sind aber auch Kundenbewertungen.
Weitere Werbeverbote gegenüber dem allgemeinen Publikum
Ebenfalls unzulässig nach § 11 Abs. 1 S. 1 HWG sind
- nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 HWG Werbeaussagen, die nahelegen, dass die Gesundheit durch die Nichtverwendung des Arzneimittels beeinträchtigt oder durch die Verwendung verbessert werden könnte. Diese Vorschrift wird für missglückt gehalten und sie spielt praktisch keine Rolle. Denn da letztendlich jede Werbung für ein Arzneimittel eine Gesundheitsverbesserung verspricht, ist unklar, was diese Vorschrift regeln soll;
- nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 HWG Werbevorträge, mit denen die Anschriften des Vortragenden überreicht oder Anschriften aus dem Publikum entgegengenommen werden. Die Vorschrift zielt auf Kaffeefahrten, bei denen Rheumadecken oder Ähnliches verkauft wird und ist praktisch bedeutungslos;
- nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 HWG Werbemaßnahmen, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder unter 14 Jahren richten;
- nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 13 HWG
Preisausschreiben und Gewinnspielen, deren Ergebnis vom Zufall abhängig ist, sofern diese Maßnahmen oder Verfahren einer unzweckmäßigen oder übermäßigen Verwendung von Arzneimitteln Vorschub leisten. Bereits die Teilnahmemöglichkeit an einem Gewinnspiel, bei dem Teilnehmer gegen Einsendung eines Rezepts einen Preis gewinnen können, ist allerdings eine unzulässige Werbegabe im Sinne von § 7 HWG (vgl. BGH, Urteil vom 18.11.2021 – I ZR 214/18 - Gewinnspielwerbung II). Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist daher praktisch gering;
- nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 14 HWG Abgaben von Arzneimitteln, deren Muster oder Proben oder durch Gutscheine dafür,
- nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 HWG nicht verlangte Abgaben von Mustern oder Proben von anderen Mitteln oder Gegenständen oder durch Gutscheine dafür.
Werbeverbote für operativen plastisch-chirurgischen Eingriffe nach § 11 Abs. 1 S. 3 HWG mit Vorher-Nachher-Bildern
Für die operativen plastisch-chirurgischen Eingriffe nach in § 1 Abs. 1 Nr. 2 c) HWG darf nicht geworben mit der Wirkung einer solchen Behandlung durch vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach dem Eingriff. "Plastische Chirurgie" ist medizinisch nicht notwendige Chirurgie, beispielsweise
- eine Haarverpflanzung (LG Berlin, Beschluss vom 12.07.2018 - 52 O 135/18 - Hair Clinic) oder
- eine Gesäßvergrößerung, "Brazilian Butt Lift" (OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.2.2022 – 15 U 24/21 - Brazilian Butt Lift).
Dabei kommt es nicht darauf an, dass die medizinische Indikation für den beworbenen Eingriff tatsächlich vorlag. Eine Werbung für plastische Chirurgie ist bereits dann verboten, wenn der angesprochene Verkehr nicht erkennen konnte, dass ein operativer plastisch-chirurgischer Eingriff medizinisch nicht notwendig war. Eine Gegenüberstellung von Vorher-/Nachher-Bildern spricht für einen medizinisch nicht notwendigen Eingriff, wenn nicht erkennbar ist, dass sich die krankhaften Beschwerden des dargestellten Patienten verbessert haben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.04.2023 – 20 U 66/22 - Verkehrsverständnis bei Werbung für chirurgischen Eingriff der Fettabsaugung an Bauch und Brust).
Verboten sind auch Werbemaßnahmen für operativen plastisch-chirurgischen Eingriffe, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder und Jugendliche richten.
Verbot von Zuwendungen und anderen Werbegaben nach § 7 HWG - Barrabatte und Mengenrabatte
Rabatte
Nach § 7 HWG darf für Heilmittel mit Zuwendungen und anderen Werbegaben nur eingeschränkt geworben werden. Nach dem § 7 I Nr. 1 HWG sind Zuwendungen und Werbegaben für Arzneimittel verboten, wenn sie gegen die Vorschriften aufgrund des Arzneimittelgesetzes verstoßen (§ 78 AMG i. V. m. AMPreisV).
> Lesen Sie hier die Auswirkungen des heilmittelwerberechtlichen Zuwendungsverbots auf die Arzneimittelpreise
Diese Einschränkung hat Auswirkung auf
Barrabatte und auf Naturalrabatte (Mengenrabatte). Denn eine "Werbegabe" ist jede aus der Sicht des Empfängers nicht berechnete geldwerte Vergünstigung (BGH, Beschl. v. 20.2.2020 – I ZR 214/18 – Gewinnspielwerbung I). Barrabatte sind zulässig, wenn es sich um einen bestimmbaren Geldbetrag handelt (§ 7 I Nr. 2 a) HWG). Keine Barrabatte sind Gutschriften für künftige Käufe (BGH, Urteil v. 17.7..2025 - I ZR 43/24 - PAYBACK-Gutschriften).
Mengenrabatte sind zulässig, wenn als Zuwendung ein gleiches Produkt gewährt wird (§ 7 I Nr. 2 b) HWG).
Ausnahmen vom Zuwendungsverbot
Geringwertige Kleinigkeiten bis zu € 1,00
Nicht jede Zuwendung oder Werbegabe ist verboten. Erlaubt sind geringwertige Gegenstände. Diese müssen aber mit einer dauerhaften und deutlich sichtbaren Bezeichnung des Werbenden oder des beworbenen Produkts oder beider gekennzeichnet sein. Ohne Werbeaufdruck sind nur geringwertige Kleinigkeiten zulässig. Zulässig sind nach § 7 Nr. 5 HWG auch Kundenzeitschriften (z.B. "Apotheken Umschau").
Unter den Begriff der geringwertigen Kleinigkeit fallen allein Gegenstände von so geringem Wert, dass eine relevante unsachliche Beeinflussung der Werbeadressaten als ausgeschlossen erscheint. Die Wertgrenze liegt bei 1 € (BGH, Urteil v. 17.7..2025 - I ZR 43/24 - PAYBACK-Gutschriften).
Für den Bereich der Arzneimittelpreise sind § 78 II Arzneimittelgesetz (AMG) i.V.m. §§ 1 I und IV, 3 Arzneimittelpreisverordnung zu beachten, insbesondere die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Ob Rabatte und Skonti verbotene Werbegaben darstellen, ist aber auch im Rahmen den § 7 HWG an den arzneimittelrechtlichen Preisvorschriften zu messen. Liegen keine Verstöße gegen arzneimittelrechtliche Preisvorschriften vor, sind Rabatte und Skonti nicht nach § 7 I 1 HWG unzulässig, weil der Ausnahmetatbestand des § 7 I Nr. 2 Buchst. a HWG eingreift (BGH, Urteil v. 5.10.2017 – I ZR 172/16 – Großhandelszuschläge).
Handelsübliches Zubehör
Auch mit der Abgabe eines handelsüblichen Zubehörs darf nach § 7 I Nr. 1 Hs 1 HWG für Heilmittel geworben werden.
Beispiel (OLG Köln v. 7.12.2018 – 6 U 95/18 – Impfstoffserviceartikel)
Wenn ein Apotheker gegenüber Ärzten für Impfstoffe wirbt und dabei kostenlose „Serviceartikel“ (Applikationshilfen – Kanülen Gr. 18 (1 Pack. / 100 Stk.), Kanülen Größe 16 (1 Pack. / 100 Stk.), Injektionspflaster (1 Pack. / 100 Stk.), Alkoholtupfer (in praktischer Box), Kanülensammler (1,5 L) im Wert von 0,8 % des Warenwertes anbietet, handelt es sich um ein solches zulässiges Zubehör.
Handelsübliche Nebenleistungen
Zulässig sind auch handelsübliche Nebenleistungen. Handelsüblich sind Nebenleistungen, wenn sie von der Hauptleistung abtrennbar sind sich nach allgemeiner Auffassung im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Gepflogenheiten halten (OLG Köln v. 20.5.2016 – 6 U 155/15 – Kostenloser Lasik-Quick-Check). Klassische erlaubte handelsübliche Nebenleistungen sind die Erstattungen von Fahrtkosten zum Geschäft mit öffentlichem Nahverkehr, nicht aber mit einem privaten Fahrdienst (z. B. Taxi).
Beispiele für Verstöße gegen das Zuwendungsverbot nach § 7 HWG
- Die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine unzulässige Werbegabe im Sinne von § 7 HWG
(BGH, Urteil vom 18.11.2021 – I ZR 214/18 - Gewinnspielwerbung II)
- Die Ausgabe eines Gutscheins für Brötchen bei Erwerb eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels in einer Apotheke ist eine unzulässige Werbegabe (BGH, Urteil v. 6.6.2019 - I ZR 206/17 - Brötchen-Gutschein).
- Die kostenlose Ausgabe eines Ein-Euro-Gutscheins durch eine Apotheke bei einem Arzneimittelkauf, der bei der nächsten Vorlage eines preisgebundenen rezeptpflichtigen Arzneimittels eingelöst werden kann, ist eine unzulässige Werbegabe (BGH, Urteil v. 6.6.2019 – I ZR 60/18 - 1 Euro-Gutschein).
Weitere Beispiele für Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz
Beispiele aus der Rechtsprechung
- Irreführend sind die folgenden Werbeaussagen für ein Medizinprodukt (Heilerde):
„Zur Unterstützung des Organismus bei der Körperentgiftung“,
„Baut als mineralischer Katalysator freie Radikale aus der Nahrung ab“,
„Bei Lebensmittelunverträglichkeit durch Histamin-Intoleranz“,
„natürliche Entgiftung“,
„Zahlreiche Studien zeigen, dass Schadstoffe und Umweltgifte den Organismus schädigen und Zellen sogar funktionsuntüchtig machen können. Müdigkeit, geringere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit oder ein geschwächtes Immunsystem können die Folge sein. Regelmäßiges Entgiften, kann Wohlbefinden, Abwehrbereitschaft und Vitalität des gesamten Organismus fördern“,
"Innere Reinigung für einen gesunden Körper“,
"Körperentgiftung und Entschlackung unterstützen“,
"Leber und Nieren entlasten“,
„Gegen belastende Substanzen, Schwermetalle, Weichmacher sowie Bakterien- und Schimmelpilzgifte aus der Nahrung“,
„Aktiver Schutz vor freien Radikalen“,
„X® Heilerde kann als mineralischer Katalysator freie Radikale natürlich und effektiv aus der Nahrung abbauen und vor Folgeschäden durch oxidativen Stress schützen“,
„X® Heilerde kann Histamine und andere biogene Amine aus der Nahrung binden. Die Beschwerden können gelindert und die Lebensqualität natürlich verbessert werden“
(OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 2.12.2021 – 6 U 121/20 - Heilerde zur Entgiftung) - Vorher-/Nachherabbildungen verstoßen oft gegen § 11 Abs. 1 HWG (z.B. OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. April 2023 – I-20 U 66/22).
Beispiele für Verstöße gegen das HWG bei Nahrungsergänzungsmitteln (NEM)
Beispiele aus der Rechtsprechung
- Bei Nahrungsergänzungsmitteln darf nicht der fälschliche Eindruck erweckt werden, es handele sich um Arzneimittel. Die Anbringung des Warnhinweises „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ ist daher irreführend, da der fälschliche Eindruck entsteht, dass es sich bei diesen Produkten um Arzneimittel handelt (OLG Dresden, Urt. v. 15. 01. 2019 – 14 U 941/18).
- Trotz der – gut lesbaren – Hinweise auf der Verpackung, dass es sich um „Tabletten zur Nahrungsergänzung” handelt, kann ein Produkt als (Präsentations-)Arzneimittel einzustufen sein, wenn die blickfangmäßig herausgestellte Produktbezeichnung, Schriftbild und Farbgebung den Verbraucher an bekannte Arzneimittel erinnern, und wenn es ausschließlich in Apotheken abgegeben wird (OLG Köln, Urteil vom 12. 10. 2007 - 6 U 56/07 Donaprevent)
- Ein Produkt zum Aufbau von Muskelmasse ist nicht zwangsläufig als Arzneimittel einzustufen. Eine die Muskeln aufbauende Wirkung eines Mittels weist nicht stets und zwangsläufig auf einen arzneilichen Anwendungszweck hin. In Betracht kommt vielmehr auch, daß ein solches Mittel der Befriedigung besonderer physiologischer Bedürfnisse und sich daraus ergebender Ernährungserfordernisse einer speziellen Personengruppe - wie hier der Hochleistungs-, Kraft- oder Ausdauersporttreibenden - dient und damit ein diätetisches Lebensmittel i.S. des § 1 Abs. 2 Nr. 1 lit. b DiätVO darstellt (BGH, Urteil vom 6. 5. 2004 - I ZR 275/01 - Sportlernahrung II).
Verstöße gegen die Health-Claims-Verordnung (HCVO) bei Werbung für Nahrungsergänzungsmittel
Werbung für Nahrungsergänzungsmittel kann auch gegen das Lebensmittelrecht verstoßen. Für Lebensmittel gilt die „Health-Claims-Verordnung" - HCVO (Verordnung [EG] Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel). Die HCVO regelt "gesundheitsbezogene Angaben" für Lebensmittel. Sie soll Verbraucher verständlich informieren. Nährwertbezogene Angaben sind nur zulässig, wenn sie im Anhang der HCVO enthalten sind und nicht gegen die HCVO verstoßen. Hier kommt es auf Details an.
Hier finden Sie
ausführliche Informationen zur
Health-Claims-Verordnung.
Verstöße gegen die Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV)
Oft wird Werbung für Nahrungsergänzungsmittel auch wegen Verstößen gegen das Lebensmittelrecht abgemahnt.
Hier finden Sie Informationen über
Verstöße gegen die LMIV bei Werbung für Lebensmittel.
Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Heilmittelwerberecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Abmahnung im Heilmittelwerberecht
Mitbewerber und Verbände können Verstöße gegen das Heilmittelwerberecht verfolgen
Abmahnungen von Mitbewerbern, qualifizierten Wirtschaftsverbänden und qualifizierten Einrichtungen
Das Irreführungsverbot des § 3 HWG ist eine Marktverhaltensregel (BGH, Urteil v. 5.11.2020 – I ZR 204/19 – Sinupret), ebenso das Verbot von Werbung außerhalb der Fachkreise nach § 12 HWG (OLG Hamm, Urteil 9.2.2023 – 4 U 144/22 - Unlautere Heilmittelwerbung) und § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HWG, das Verbot der Heilmittelwerbung mit fachlichen Empfehlungen (BGH, Urt. v. 18.1.2012 − I ZR 83/11 - Euminz) und das Werbeverbot für operativen plastisch-chirurgischen Eingriffe nach § 11 Abs. 1 S. 3 (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.04.2023 – 20 U 66/22 - Verkehrsverständnis bei Werbung für chirurgischen Eingriff der Fettabsaugung an Bauch und Brust). Diese Verbote können daher von Mitbewerbern, qualifizierten Wirtschaftsverbänden (z.B. dem Verband Sozialer Wettbewerb e.V. oder der Wettbewerbszentrale) und qualifizierten Einrichtungen mit Abmahnungen im Wettbewerbsrecht und einstweiligen Verfügungen verfolgt werden.
Häufig abgemahnte Verstöße
- Klassische Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz (HWG) sind beispielsweise irreführende Werbungen für Arzneimittel mit Rezeptfreiheit.
- Häufig beanstandet werden auch Verstöße gegen das Zuwendungsverbot (§ 7 Abs. 1 HWG), beispielsweise produktbezogene Werbung mit nicht nur geringwertigen Zuwendungen (z.B. Gutscheine, Prämien) oder kostenloser Beratung.
- Häufig werden auch die nach §§ 11 ff. HWG verbotenen bestimmten Werbungen außerhalb der Fachkreis beanstandet, z.B. Werbung mit Empfehlungen von Testimonials gegenüber Verbrauchern.
- Bei Werbung mit wissenschaftlichen Studien wird regelmäßig beanstandet, dass diese nicht den anerkannten Regeln der wissenschaftlichen Forschung entsprechen. Das ist der Fall, wenn keine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung vorliegt, die durch Veröffentlichung in den Diskussionsprozess der Fachwelt einbezogen worden ist.
Abmahnungen des Verbands sozialer Wettbewerb e. V., Berlin
Dem Verband gehören unter anderem Apothekerkammern, Ärztekammern, der Verband Deutscher Versandapotheken, Versandhändler aller Art, Sanitätshäuser mit Reform- und Drogerieprodukten, Heilpraktiker, Hersteller von Arzneimitteln udn Kosmetika, Betreiber von Kurkliniken, Anbieter von Naturheilmittel, von pharmazeutischen Produkten und Unternehmen aus der Lebensmittelbranche an. Der Verband sozialer Wettbewerb e. V. rügt vor allem Verstöße im Bereich Lebensmittel, Heilmittel, Kosmetik, Gesundheit und Wellness. Der Verband setzt kurze Fristen zur Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklärung. Dennoch sollten Unterlassungserklärungen nicht vorschnell unterschrieben werden. Hier hilft ein Anwalt für Heilmittelwerberecht. Der Verband sozialer Wettbewerb fordert Verstöße gegen eine einmal abgegebene Unterlassungserklärung konsequent ein.